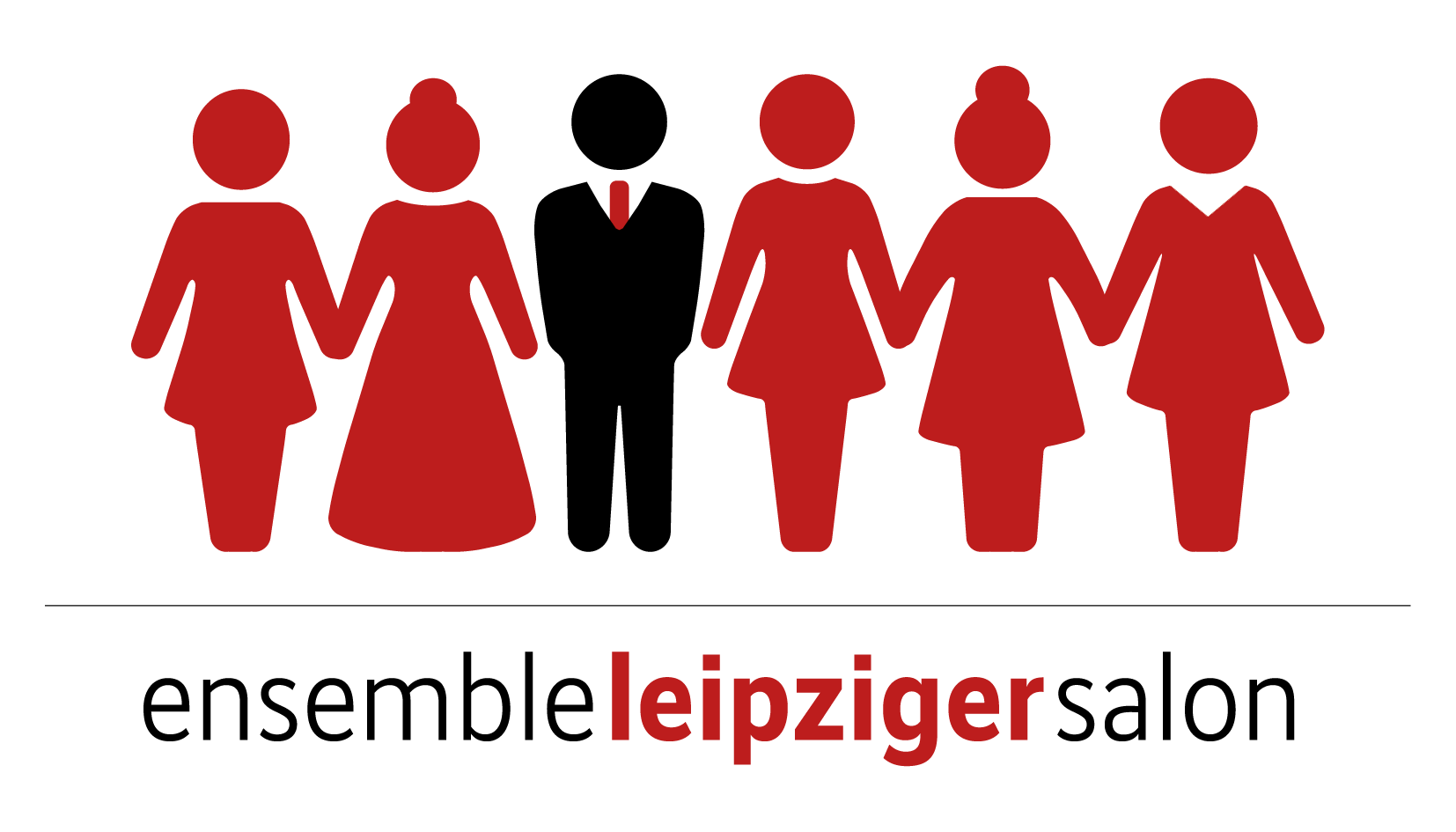Für jeden Anlass die perfekte Note
Ob für eine Hochzeitsfeier, den 80. Geburtstag vom Opa (auf Initiative der Enkel…) oder die anspruchsvolle Begleitmusik in Ihrem Kaffeehaus: das ensembleleipzigersalon bietet Ihnen unvergessliche Stunden!
Salonmusik ist mehr als virtuos-elegant dargebrachte, gefällige, aber anspruchslose Musik.
Wir treten gern den Beweis an:
Die fünf Damen und der eine Herr sind sämtlich studierte Musiker ihres Fachs – und zusammen das
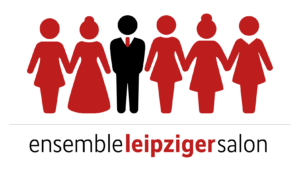
Saskia Klapper
VIOLINE
war Schülerin des Musikgymnasiums „Schloss Belvedere“ in Weimar und studierte dort anschließend bei Wladimir Malinin und in Leipzig bei Ulrich Klupsch. Ihr Diplom und Konzertexamen erspielte sie sich mit Auszeichnung! Danach sammelte sie zunächst Orchestererfahrung durch Anstellungen in der Staatsoperette Dresden, der Musikalischen Komödie der Oper Leipzig und der Dresdner Philharmonie.
Saskia Klapper ist eine gefragte Aushilfe, u.a. bei der Musikalischen Komödie der Oper Leipzig, der Robert Schumann Philharmonie Chemnitz und beim Theater Zwickau Plauen. Neben zahlreichen Konzerten und CD-Produktionen im In- und Ausland ist sie als begeisterte Barockgeigerin in Ensembles wie dem Leipziger Barockorchester, der Merseburger Hofmusik, der camerata lipsiensis, dem Pauliner Barockensemble, dem Sächsischen Barockorchester und der Lautten Compagney tätig. Außerdem ist sie Konzertmeisterin der capella fidicinia.
Ihre musikalische Inspiration erhält sie durch Dirigenten wie David Timm, Michael Schönheit, Gregor Meyer oder Gotthold Schwarz.
Julia Andreas
VIOLINE
studierte Violine in Berlin bei Antje Weithaas und Ina Kertscher. Nach dem Diplom absolvierte sie ein Aufbaustudium in Weimar und machte das Konzertexamen/Orchesterakademie am Gewandhaus zu Leipzig. Sie spielte auf verschiedenen Zeitverträgen, u.a. in der Dresdner Philharmonie und am Gewandhaus zu Leipzig. Unterrichtserfahrung mit Kindern und Erwachsenen sammelte sie an privaten Musikschulen in Berlin und Weimar. Sie ist Mutter zweier Kinder und lebt freiberuflich in Leipzig.
Andrea László
VIOLONCELLO
studierte bei Ede Banda an der Franz-Liszt-Musikakademie in Budapest und rundete ihrE Studien durch ein DAAD-Stipendium bei Christoph Richter in Essen ab. Sie wirkte als Solistin und Kammermusikerin bei verschiedenen Musikfestivals mit (u.a. Villa Musica, Schleswig-Holstein Musikfestival). Des weiteren trat sie unter der Leitung von Leonard Bernstein, Sir Georg Solti, Claudio Abbado und Sir Yehudi Menuhin auf.
Mehrere Jahre war Andrea László im Orchester des Nationaltheaters Mannheim tätig. Seit 2003 arbeitet sie im Orchester der Musikalischen Komödie der Oper Leipzig und ist Mitglied des LipsiaQuartetts.
Astrid Travagli
KONTRABASS
Astrid Travagli wurde 1978 in Au bei Freiburg im Breisgau geboren. Schon früh sang und musizierte sie u.a. im Kinderchor des Theaters Freiburg. Den Kontrabass entdeckte sie im Alter von 14 Jahren und begann bei Wolfgang Kölmel Unterricht zu nehmen. Später wechselte sie in die Vorklasse der Musikhochschule Freiburg zu Wolfgang Stert und nach dem Abitur an die Musikhochschulen Mannheim, Detmold und Frankfurt am Main zu Prof. Christoph Schmidt.
Nach Zeitverträgen im Orchester der Oper Saarbrücken, dem SWR Rundfunkorchester und der Staatskapelle Halle wechselte sie 2011 in die Freiberuflichkeit. Ihre Tätigkeit führte sie bis nach Berlin an die Deutsche Oper, zum WDR Sinfonieorchester Köln, zum SWR Sinfonieorchester Baden – Baden und Freiburg, zur Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin, zum Staatsorchester Braunschweig und an viele andere Häuser. Außerdem ist sie regelmäßig bei der Staatskapelle Weimar zu Gast.
Neben dem Orchesterspiel widmet sie sich dem 2015 mit Julia Andreas gegründeten Ensemble Leipziger Salon.
Valeri Funkner
BAJAN
ist in der Ukraine geboren, wuchs im russischen Altai auf und siedelte mit 15 Jahren in die DDR nach Leipzig um. Von 1978 bis1982 studierte er an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar in den Fächern Akkordeon und Plektrum-Gitarre. Neben seiner Unterrichtstätigkeit trat er am Anfang seiner Laufbahn mit russischer Folklore bei vielen Festivals in der DDR und Osteuropa auf. Später folgte eine umfangreiche Konzerttätigkeit in verschiedenen Ensembles in den Genres Klassik, Chanson, Theatermusik, Folklore. Als Akkordeonist spielte er in einigen Kammer- und Sinfonieorchestern mit, u.a. mit dem MDR Sinfonieorchester sowie den Orchestern der Oper und der Musikalischen Komödie Leipzig. Parallel dazu befasste er sich mit der Musik von Astor Piazzolla, was schließlich 1998 zur Gründung des Quintetts Tango nuevo und der Realisierung des Projektes „Hommage á Piazzolla“ führte. In den folgenden Jahren kamen noch weitere Tango-Projekte dazu: 2002 gründete er gemeinsam mit der Tangopianistin Anja Bartsch das Tango-Orchesters Leipzig „Abriendo y Cerrando“.
Valeri Funkner ist als Arrangeur und Studiomusiker an vielen Projekten beteiligt und kann zahlreiche CD-, Studio-, Fernseh- und Rundfunkproduktionen vorweisen. Er trat in mehreren Filmen als Musiker auf, u.a. im „Tatort“, „In aller Freundschaft“ oder „Tierärztin Dr. Mertens“. Er komponierte einige Filmmusiken, u.a. den „Tango“ zu dem Film „Das Monstrum“ (Regie: Miriam Pfeiffer & René Reinhardt) oder „Das fliegende Klassenzimmer“ (Regie: Tomy Wigand).
Valeri Funkner spielt auf dem Bajan (Knopfakkordeon). Die Bezeichnung seines Instrumentes stammt aus dem Russischen, wird aber auch in der Akkordeon-Fachwelt als Begriff für ein konzertantes Akkordeon benutzt.
Sophie Auerbach
PIANO
studierte an den Hochschulen für Musik „Franz Listz“/ Weimar, „Hanns Eisler“/ Berlin und an der Universität für Musik in Bukarest. Sie ist Preisträgerin nationaler und internationaler Wettbewerbe (1. Preis Grotrian Steinweg Wettbewerb / Braunschweig, 1. Preis Nikolai Rubinstein Wettbewerb / Paris). Meisterkurse u.a. bei Ringeissen, Canino und Bermann vervollständigten ihre musikalische Ausbildung. Außer in Europa konzertierte Sophie Auerbach bereits in Teheran/Iran.
Als Lehrbeauftragte der Universität der Künste in Berlin korrepetierte sie verschiedene Opernproduktionen, Festivals (Kurt Weill Festival in Dessau) und bei Gesangswettbewerben und Preisträgerkonzerten von Sängerinnen und Sängern (Bundesgesangswettbewerb/ Staatsoper Unter den Linden). Seit 2012 engagiert sich Sophie Auerbach ehrenamtlich in der GEDOK e.V. und agierte 2012-2014 als Bundesfachbeirätin des Vereins. Seit 2011 ist SIE als Korrepetitorin an der Musikschule „J.S.Bach“ in Leipzig tätig. An der gleichnamigen Musikschule in Köthen unterrichtet sie Klavier und Musiktheorie.
Hörbeispiele
Chim Chim Cher-ee
Im Tango-Takt
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt
Dein ist mein ganzes Herz
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts sind diese Abendgesellschaften von immer breiteren Schichten des Bürgertums imitiert worden und verloren dadurch in sozialer wie künstlerischer Hinsicht ihre Exklusivität. Die musikalische Umrahmung besorgte nun die Dame des Hauses oder deren Töchter, in der Regel auf dem Klavier. Dafür entstand eine massenhafte Klavierliteratur, die sowohl den spieltechnischen Möglichkeiten musikalischer Laien als auch der prestigebeladenen Funktion einer möglichst attraktiven Umrahmung bürgerlicher Geselligkeit angepasst war. Von vornherein tendierte sie damit zur Veräußerlichung eines auf Sentimentalität und Scheinvirtuosität zielenden Gehalts, hatte sie doch mit dem Anspruch auf spieltechnische Brillanz und emotionaler Ausdruckskraft etwas zu sein, was sie hier gar nicht mehr sein konnte.
Das Repertoire setzte sich zusammen aus Charakter- und Genrestücken ohne feste Form mit meist sehr bildhaften Titeln (»Der brüllende Löwe«, »Glocken des Himmels« usw.), aus auf spieltechnische Effekte hin angelegten Vortragsstücken meist in Form stilisierter Tanzmusik (Walzer, Polonaise usw.), aus Charakterstücken mit exotischem Einschlag (Barkarole, Tarantella, Rhapsodie espagnol usw.) und einer Vielzahl von Bearbeitungen diverser Orchestermusik, entweder als gekürztes und vereinfachtes Klavierarrangement oder in der Zusammenstellung als Potpourri beliebter Melodien. Um 1830 tauchte dafür die Bezeichnung Salonmusik auf, wobei sich ihre charakteristischen Eigenschaften massenhaft erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auszuprägen begannen.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gelangte diese Musik auch in die Caféhäuser und Restaurants, wo sie auf eine kleine Instrumentalbesetzung (Salonorchester) übertragen wurde und schließlich darin eine vereinzelt bis in unsereTage reichende Fortsetzung fand (Caféhaus-Musik). Sie selbst überlebte noch die Jahrhundertwende in der bürgerlichen Hausmusik und auch als Spielliteratur im Klavierunterricht.
Quelle: Universal-Lexikon
Kontakt
Ihnen gefällt, was Sie gelesen und gehört haben? Dann kontaktieren Sie uns für einen Auftritt bei Ihnen!
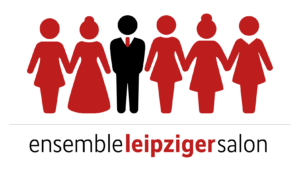
Astrid Travagli
astridpfister@icloud.com